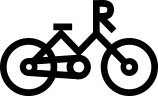Da steckt was im (Krahner) Busch
Beim ersten Besuch in Krahne war Mark Radler nicht mehr dazu gekommen, das nahegelegene Naturschutzgebiet „Krahner Busch“ aufzusuchen (siehe MR No19, Erfahrung 1) . Fast ein Jahr später wird das Verpasste nachgeholt.
Erstmal nur „ausgeräumte“ Landschaft
Nachdem das „Jägergeheul“ verdaut ist (s. MR No30), geht es über die Plane mitten in die Niederung hinein. So wie die Plane selbst erscheint hier aber leider auch der Rest der Niederung überwiegend nicht mehr sehr natürlich. Die Landschaft ist weitgehend ausgeräumt, überall stößt man auf gerade Linien und Kanten, auch die Wege verlaufen überwiegend schnurgerade und mitunter in rechten Winkeln abknickend durch die Landschaft. Zum Wandern wäre mir das hier zu eintönig und ermüdend. Mit dem Rad kommt man da wenigstens schnell durch. Trotzdem schade.
Was ist da nur im Busch?

Vor lauter Frust vergesse ich glatt die Leere fotografisch zu dokumentieren. Ich bin ganz von der Suche nach dem Naturschutzgebiet gebannt. Rechts des Weges werden die Wiesen – geradlinig – von Wald begrenzt. Das muss er sein, der „Krahner Busch”. Als Busch werden im Brandenburgischen übrigens Wald- oder Gehölzbestände auf feuchten bis nassen Böden bezeichnet, also meist Erlen-, Erlen-Eschen- oder Eichen-Hainbuchenbestände oder -wälder. Die Bezeichnung „Busch“ weist uns darauf hin, dass diese Gehölzbestände früher in der Regel keine natürlichen Hochwälder waren, sondern mehr oder weniger intensiven Nutzungen unterlagen und daher buschartigen Charakter hatten. Bereits im Mittelalter wurden die Niederungen entwässert, was in der Neuzeit dann noch erheblich intensiviert wurde, und auch die Niederungswälder intensiv genutzt, meist in Form so genannter Niederwaldbewirtschaftung, bei der etwa alle 10 bis 30 Jahre die Baumbestände parzellenweise gefällt bzw. auf Stock gesetzt wurden. Dies geschah in der Regel im Winter, also bei gefrorenem Boden. Die Bäume schlagen dann im nächsten Frühjahr aus den Stümpfen mit mehreren Trieben wieder aus. Aufgrund der regelmäßigen Nutzung konnten diese Bestände nicht auswachsen und wurden daher als „Niederwald“ bezeichnet. Die hiesigen Erlenbrücher wurden fast durchweg entsprechend genutzt. Man erkennt sie an ihren mehrstämmigen Beständen, d.h. mehrere Stämme wachsen aus einem Wurzelstock. Das Holz der Niederwaldbewirtschaftung diente meist als – minderwertiges – Brennholz, stellte also einen nachwachsenden Brennstoff dar. Entsprechende Bestände finden wir auch im Krahner Busch. Traditionell wurde in diesen Gebieten auch Schilf geerntet, das früher zum Dachdecken und z.B. zur Füllung von Lehmwänden verwendet wurde und damit ein einst begehrter – ebenfalls nachwachsender – Baustoff war. Für den Krahner Busch ist auch diese Nutzung überliefert. Nachwachsende Rohstoffe sind also keine Erfindung unserer Tage, sie waren in der vorindustriellen Zeit vielmehr wesentliche Grundlage des Wirtschaftslebens. Aber man sollte diese Wirtschaftsweise nicht verklären, denn sie führte bereits im Mittelalter zu großflächigem Raubbau und weitreichender Naturzerstörung. Laut einer Publikation des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg hatte es in Brandenburg bereits zum Ende des 13. Jahrhunderts, also nur etwa 100 bis 150 Jahre nach Beginn der deutschen Kolonisation, keine rodungsfähigen Wälder mehr gegeben. Überall wurde Holz benötigt und in großen Mengen verbraucht: beim Bau der Dörfer, Städte, Burgen, Wege und Schiffe, oder beim Handwerk, in Glas- und Eisenhütten, in Aschebrennereien, Köhlereien, Teerschwelen oder in den unzähligen Feuerstellen der Siedlungen. Vor allem Alteichen waren auch ein Exportschlager der eichenreichen Mark Brandenburg. So war der einstige Hochwald bereits im Mittelalter nahezu flächendeckend geschlagen, die Starkbäume verbaut und verkauft, der Rest zum großen Teil verheizt. Das ganze Land war von Erosion bedroht. Alle heute bestehenden Waldbestände sind damit neuzeitliche Neubegründungen.
(Talsand-) Inseln als Waldrefugien

Die naturschutzfachlich wertvollsten Waldbestände des Krahner Busches wachsen auf den kleinen Talsandhorsten bzw. Talsandinseln. Diese leicht erhöhten und nicht überstauten Flächen werden hier vom recht seltenen Eichen-Hainbuchenwald eingenommen. Die obere Baumschicht wird von Stieleiche geprägt, daneben kommen Hainbuche, Esche, Berg-Ahorn, Ulme und Rotbuche vor. Auch die Strauchschicht ist artenreich mit Hasel, Pfaffenhütchen, Hartriegel, Weißdorn, Kreuzdorn u.a.

Im Frühjahr betört einen der Blühaspekt der Gewöhnlichen Traubenkirsche mit ihren weißen Blütentrauben und dem angenehm süßlichen Duft. Besonders hervorzuheben – und typisch für diese Waldgesellschaft – ist die üppige Bodenvegetation, von der einen hier insbesondere die farbliche Vielfalt der Frühjahrsblüher begeistern kann. Genannt seien Weißes und Gelbes Buschwindröschen, Leberblümchen, Lungenkraut, Lerchensporn, Hain-Sternmiere, Gefleckte Taubnessel, Frühlings-Platterbse, Waldmeister oder die urig wirkende Schuppenwurz.

Taubhnessel

Schuppenwurz
Der schönste Waldbestand findet sich im Südwesten des Naturschutzgebietes. Freilich ist er nur über einen schwer zugänglichen – und verzeckten – Stichweg erreichbar, aber auch die übrigen Teile des Schutzgebietes sind nur bedingt zugänglich. Der Krahner Busch gehört zu den zahlreichen Naturschutzgebieten in Brandenburg, mit denen zwar touristisch geworben, die aber für Interessierte nicht wirklich erlebbar gemacht werden. Wozu anzufügen ist, dass der besondere Wert des Krahner Busches von außen betrachtet nicht allzu deutlich ins Auge sticht.

Dringt man über den besagten Stichweg etwas in diesen Eichen-Hainbuchenwald vor, fällt einem der sehr lockere, fast parkartige Stand der Hauptbaumschicht ins Auge. So lichtungsreich kennt man Wald und Forst in unseren Breiten kaum und die Wenigsten dürften sich so einen Naturwald vorstellen, der eher als etwas Undurchdringliches erwartet wird. Tja, und tatsächlich sind auch diese lichten Strukturen in erster Linie Folge einer – weiteren – intensiven Waldnutzung. Nicht zu feuchte Wälder wurden insbesondere seit dem Mittelalter – bis ins 19. Jahrhundert – nämlich auch zur Waldweide genutzt, also das Vieh der Gemeinden oder Gutsherrschaften zur Beweidung in die Wälder getrieben. Damals, in der ärmlichen vorindustriellen Zeit, musste eben alles genutzt werden, was irgendwie habbar war. Natürlich hat die Waldweide die Naturverjüngung der Gehölzbestände stark eingeschränkt und auch zur Verhagerung der Standorte geführt – und dabei entstanden oftmals sehr lichte Waldbestände, die zum Teil – in veränderter Form – bis heute erhalten sind und als ehemalige Hutewälder inzwischen verständlicherweise von Naturschützern als besonders struktur- und artenreiche Waldbestände sehr geschätzt werden. In der Folge wird heute von vielen Naturschützern die Waldweide in den Himmel gelobt und vielfach deren Wiedereinführung gefordert. Aber auch hier sei vor Verklärung gewarnt, denn die Hutewälder waren damals weitgehend ausgeräumte und abgeweidete Gehölzflächen und wurden eben gerade nicht von (lichten) Altbaumbeständen geprägt. Diese, also die (lichten) Altbaumbestände, entwickelten sich meist erst nach Aufgabe der intensiven Waldnutzung bzw. Waldweide.
Gedanken über den „Urwald“ unserer Breiten

An diesem Punkt kommen wir nun zum Glaubensbekenntnis des heimischen Natur- oder Urwaldes. Es stellt sich nämlich immer wieder die Frage, wie wir uns den natürlichen Wald, den Urwald, unserer Breiten vorstellen können. Stimmt es, dass er so licht war oder wäre, wie etwa die heutigen Hutewaldreste, weil unter natürlichen Bedingungen wilde Rindviecher- und Pferdeherden – und Naturkatastrophen – die Wälder auf Dauer so licht halten würden? Oder war und wäre der Naturwald ein dichter, dunkler und undurchdringlicher Wald, wie ihn Tacitus für Germanien um das Jahr 100 beschrieben hat? Die Frage ist schwer und einfach zugleich zu beantworten: Denn es gibt ihn nicht, den unveränderlichen Ur- oder Naturwald als immergültige Blaupause. Denn Wald ist ein anhaltender dynamischer Prozess, der, sieht man einmal vom Menschen und seiner Bewirtschaftung ab, vor allem vom Klima, vom Wasserhaushalt, der Bodenbildung und von der natürlichen Sukzession abhängt. Der „Urwald“ der Steinzeit sah zwangsläufig anders aus als der Urwald der römischen Kaiserzeit oder der Urwald kurz vor der flächendeckenden Rodung im Mittelalter. Seitdem hat es Urwald in Mitteleuropa gar nicht mehr gegeben. Während in der mittleren Steinzeit in unseren Breiten tatsächlich sehr lichte Eichenwälder dominierten, in denen wilde Großtierherden noch ausreichend Platz fanden, wurden diese Wälder in den folgenden Jahrtausenden immer dichter, es breiteten sich Hain- und Rotbuchen aus, die Humusauflagen wurden höher und die wilden Großtierherden immer seltener. Durch die zunehmende menschliche Besiedlung wurden die Wälder partiell zurückgedrängt und damit auch der Rückgang der Großtierherden beschleunigt. Infolge der Völkerwanderung und der damit einhergehenden Entsiedelung dehnten sich die Wälder zeitweilig wieder aus, bis durch die Zuwanderung der Slawen ab dem 6. Jahrhundert sich die entwaldeten Siedlungsgebiete wieder langsam ausdehnten. Dennoch wurden zwischen Elbe und Oder bis ins 11. Jahrhundert hinein riesige, zusammenhängende Flächen von naturbelassenen – vermutlich recht dichten – Wäldern eingenommen, denn diese bildeten offensichtlich massive Barrieren zwischen den von unterschiedlichen Slawenstämmen besiedelten Siedlungskammern. Archäologische Befunde zeigen auf, dass sich die Jagdbeute der hiesigen Slawen zum größten Teil aus Rotwild, Reh und Wildschwein zusammensetzte, während Ur (Auerochse)und Wisent nur einen geringen Anteil hatten. Es ist daher durchaus fraglich, dass in den bestehenden Waldgebieten zu dieser Zeit noch ausreichend Großtierherden vorhanden waren, um hier relavante Auflichtungen der Naturwaldbestände annehmen zu können. Auch aus den mittelalterlich-deutschen Quellen und archäologischen Funden lassen sich keine Hinweise auf im Land noch verbreitete Großtierherden finden. Dabei können wir davon ausgehen, dass solche Herden, hätte es sie im Mittelalter noch in namhafter Zahl gegeben, intensiv bejagt worden wären und dies auch in den Quellen breite Erwähnung gefunden hätte. Wir können daraus schließen, dass es historisch nicht zu begründen ist, wie unser Naturwald heute aussehen sollte oder müsste. Das müssen wir schon selber (neu) definieren. Die Vergangenheit kann uns dabei Anregungen und gewisse Vorlagen liefern, aber sie zeigt uns nicht den einzig wahren und richtigen „Urwald“. Denn den gibt es nicht.

Flächennaturschutz seit den 1960er Jahren
Aber zurück zum Krahner Busch. Zum Schutz der letzten Niederungswälder im Planetal wurde der Krahner Busch im Jahr 1967 mit einer Fläche von 9,5 ha als Naturschutzgebiet gesichert und 1978 auf eine Größe von 18,2 ha erweitert. Leider hatte diese Unterschutzstellung nicht die intensivierte Trockenlegung/ Melioration der umgebenden Planeniederung verhindern können. In einer fachkundigen Gebietsbewertung im Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR wird Anfang der 1980er Jahre durchaus kritisch auf zahlreiche wipfeltrockene Stieleichen verwiesen, die auf Grundwasserabsenkungen als Folge umfangreicher Meliorationsmaßnahmen in der Umgebung des NSG zurückgeführt wurden. Höchstwahrscheinlich sind dieser großflächigen Entwässerung – wie auch der intensivierten Nutzung der Umgebung – ebenso zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zum Opfer gefallen. So isoliert praktiziert macht Naturschutz also wenig Sinn. Es bringt nicht wirklich etwas, ein Schutzgebiet auszuweisen, wenn im direkten Umfeld weiterhin „Tabula rasa” betrieben wird.
Geradezu melancholisch kann man angesichts der Tatsache werden, dass hier in den Biotopen des Krahner Busches noch zu Beginn der 1960er Jahre Birkhuhn und Blauracke vorgekommen sind. So etwas wäre heutzutage eine glatte Sensation. Lang, lang ist’s her. Auf der anderen Seite so lange nun auch wieder nicht. Erfreuen wir uns also an dem, was wir noch haben. Und gehen damit sorgfältiger um als vorige Generationen.
Nachdem ich die Zecken von der Hose abgesammelt habe, geht es in südöstliche Richtung weiter.